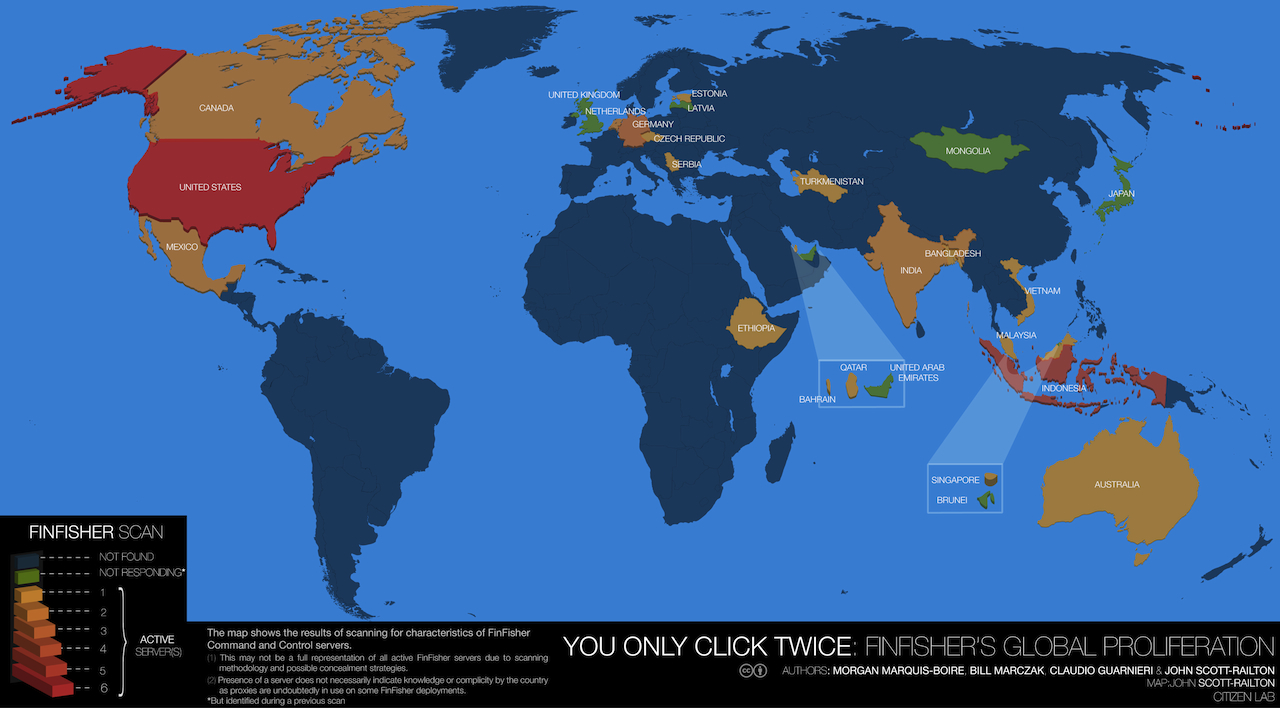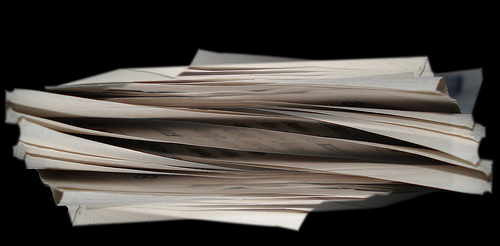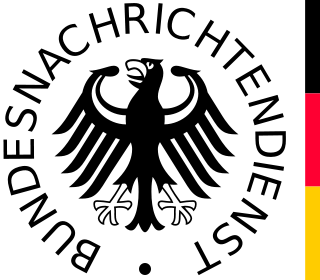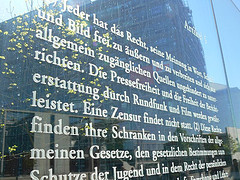Champagner.
Eigentlich hätte am Dienstag der Prozess wegen “schwerem, aufwieglerischem Landfriedensbruchs” (§125a StGB) gegen Lothar König, den Stadtjugendpfarrer von Jena, begonnen. Am Montag ist der Start des Prozesses an der Dämlichkeit der sächsischen Behörden gescheitert. Wenn es nicht so ernst wäre, wäre es zum Schreien komisch.
Was ist passiert? Kurz vor Prozessbeginn ist ein Stapel Material in den Prozessakten aufgetaucht, den die Verteidigung noch nie gesehen hatte. Wie kam der dahin? Warum war der vorher nicht da?
Dass Prozessakten nicht vollständig sind, ist nicht ungewöhnlich. Das ist nicht vorgesehen und immerhin haben wir ja einen Rechtsstaat und so, aber faktisch passieren trotzdem in deutschen Gerichten die bizarrsten Dinge, weil, guckt ja niemand so genau hin. Wo wir doch den Rechtsstaat…
Dass allerdings ausgerechnet in diesem Prozess mal eben ein
etwa 100 Blatt starkes ungeordnetes Konvolut von Lichtbildmappen, CD-Rom mit anklagerelevanten Videomaterial und polizeilichen Auswertungsmaterialien (JG Stadtmitte)
vom Himmel fällt, bestätigt alle Vorurteile über die sächsische Justiz. Es gibt eigentlich nur zwei mögliche Interpretationen: die StaatsanwältInnen plus Polizei sind sich sehr sicher, dass ihnen da niemand reinpfuscht. Oder haben den Bezug zu den letzten Resten demokratischer Rechtsstaatlichkeit vollständig verloren. (Jedesmal, wenn ich über die schreibe, frage ich mich, ob ich bei der nächsten Einreise festgenommen werden. Deswegen, liebe Zensoren: das sind Vermutungen, keine Behauptungen. Ok?)
Nun ist es aber so, dass die ganze Republik diesen Prozess beobachtet. Und Lothar König einen Anwalt hat, der in Berlin als Kettenhund des Politischen Prozesses bekannt ist: Johnny Eisenberg, der schon aus kleineren Anlässen größere Skandale fabriziert. Der hat dann kurz die Augenbrauen hochgezogen und das Gericht in Dresden hat den Prozess jetzt verschoben. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Noch ein bisschen zum Prozess an sich. Die FR fasst das so zusammen:
Ein Pfarrer aus Jena kämpft seit Jahren gegen den Einfluss von Neonazis. Jetzt muss er vor Gericht, weil er an einer Demonstration teilgenommen hat, die sich gegen den größten Aufmarsch von Neonazis in Europa richtete.
http://vimeo.com/60934455
Mehr über Lothar König:
http://vimeo.com/60830525
Er selbst dazu:
Seit der Wohnungsdurchsuchung im August 2011 ist mir eine ungeahnte Solidarisierung zuteilgeworden. Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet; aus Antifagruppen, Kirchen, Gewerkschaften, aus allen Parteien und allen Altersgruppen haben mir geschrieben und/oder für die Prozeßkosten gespendet. Das hat mir mein Engagement und das Durchhalten wesentlich erleichtert. Nur wenigen konnte ich bisher ein Dankeschön zurückgeben.
Ich will aber nicht verhehlen, daß die Vorbereitungen auf den anstehenden Prozeß zeitlich und kräftemäßig an den Rand der Belastbarkeit führen. Die Ungewißheit seines Ausganges und die drohende Vergeblichkeit aller Anstrengungen führen an die Grenzen, was ich gegenüber mir und anderen verantworten kann . Hinzu kommt der enorme finanzielle Aufwand.
Ein Scheitern ist immer möglich. Doch trotz aller Ohnmacht, trotz eigener Zweifel und Fragen , trotz drohender Sinnlosigkeit aller Bemühungen sage ich: „ . . . nichts, nichts was ich hätte tun oder lassen, wollen oder denken können, hätte mich an ein andres Ziel geführt. “ (Christa Wolf)
So ist die Verurteilung von Tim H. und die drohende von mir kein Scheitern von uns. Es ist das Scheitern einer Justiz, die antifaschistisches und demokrat- isches Engagement kriminalisiert.

Jena, im Februar 2013, Lothar König, Pfarrer
Wer spenden möchte, kann das hier machen: www.prozesskostenhilfe-lothar.de
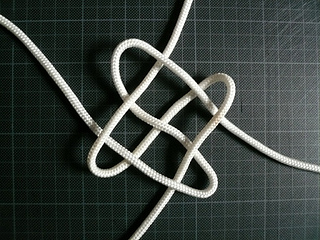 Es gibt Sachen, bei denen ist es echt schwierig, Verschwörngstheorien auszuweichen.
Es gibt Sachen, bei denen ist es echt schwierig, Verschwörngstheorien auszuweichen.